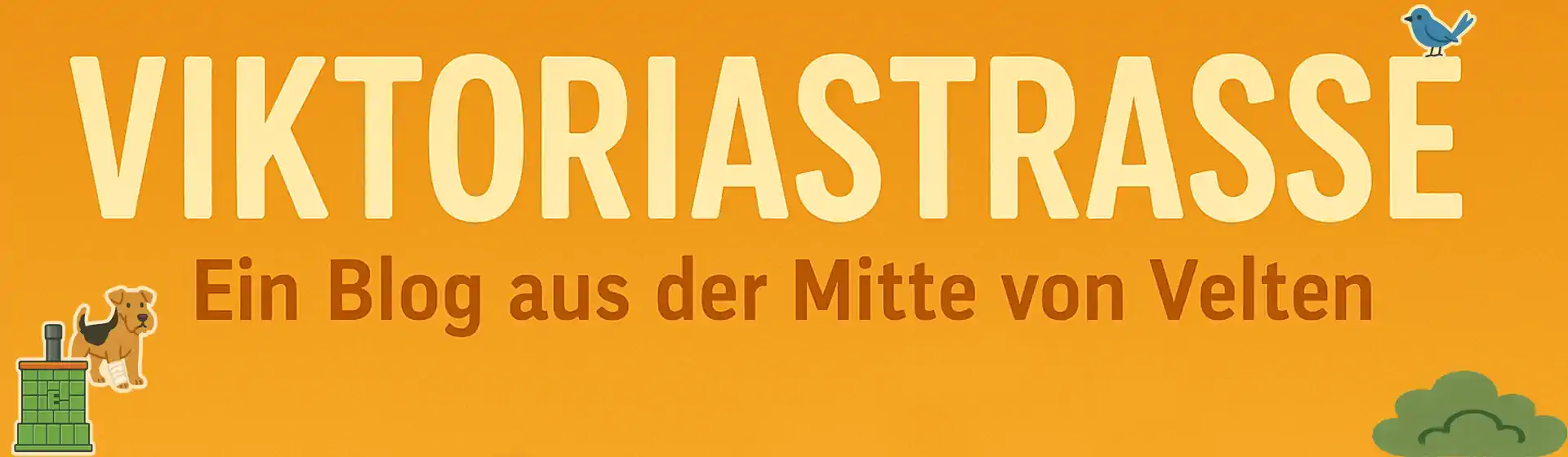Einmal mehr verwandelte sich das Ofen- und Keramikmuseum Velten heute in einen Ort des Austauschs zwischen Wissenschaft und Bürgerschaft. Die Überbleibsel des Familienfestes waren noch zu sehen und sogar ein Schornsteinfegerrad sorgte für Glück. Ein wirklich schöner und stimmungsvoller Veranstaltungsort, großes Lob ans Museum. Zum zweiten Mal luden die Präsenzstelle der Hochschulen des Landes Brandenburg und der Seniorenbeirat Velten zu einem „Hochschulhappen“ ein – diesmal unter dem Titel „Robotik in der Pflege“.

Trotz der Verlockungen des Sommers fanden sich zahlreiche Gäste ein, um zu erfahren, welche Chancen, aber auch welche Herausforderungen der Einsatz sozialer Roboter im Pflegealltag mit sich bringt. Schließlich kann man auch noch nach dem Vortrag zum Italiener gehen. Die Veranstaltung war nicht nur ein informativer Vormittag, sondern auch eine Gelegenheit, Technik hautnah zu erleben – mit gleich drei robotischen Begleitern: der bekannten Kuschelrobbe Paro, dem kommunikativen System Navel und dem humanoiden Roboter Dr. Theodore von Peppe.
Als Referenten begrüßten wir Prof. Dr. Robert Ranisch sowie Dr. Joschka Haltaufderheide und Dr. Ruben Sakowsky von der Juniorprofessur für Medizinische Ethik mit Schwerpunkt auf Digitalisierung der Fakultät für Gesundheitswissenschaft der Universität Potsdam.
Begrüßung durch Mensch und Maschine
Der erste Eindruck: überraschend sympathisch. Prof. Dr. Robert Ranisch, Juniorprofessor für Medizinische Ethik an der Universität Potsdam, trat gemeinsam mit dem sprechenden Roboter Navel vor das Publikum. „Willkommen im Ofenmuseum“, sagte Navel klar und freundlich – und wusste dabei genau, wo er war. Etwas holprig wurde es, als Navel zum Schluss mit „Joschka“ antwortete – obwohl sein Gesprächspartner Robert hieß. Der Fauxpas wurde mit einem Schmunzeln quittiert – ein echter Eisbrecher. Ja, KI ist noch nicht perfekt, beinahe menschlich.

Prof. Ranisch stellte sich anschließend selbst vor und erläuterte sein Arbeitsfeld: die ethische Reflexion neuer Technologien im Gesundheitswesen. Seine Professur ist Teil eines vom Bundesministerium für Gesundheit geförderten Projekts mit dem Titel „E-Care – Bürgerkonferenz Robotik in der Altenpflege“, das sich mit der verantwortungsvollen Integration von Robotern in Pflegekonzepte beschäftigt.
Zwischen Kuscheltier und Künstlicher Intelligenz
Doch was ist eigentlich ein sozialer Roboter? Diese Frage wurde im Laufe des Vortrags mehrfach gestellt – und endlich auch klar beantwortet: Soziale Roboter seien keine bloßen Servierwagen oder Greifarme. Erst wenn sie menschliche oder tierische Eigenschaften annehmen, sich an unsere Kommunikation anpassen und emotionale Bindung zulassen, sprechen wir von sozialer Robotik.

Der Wissenschaftler der Universität Potsdam führte zahlreiche Beispiele an – von der Kuschelrobbe Paro, die bei Demenzkranken beruhigend wirken soll, bis zum japanischen „Pflegebären“, der auf menschliche Stimmen reagiert. Das Erscheinungsbild könne humanoid oder zoomorph sein – entscheidend sei die soziale Wirkung. In Europa gebe es hier noch Zurückhaltung, aber auch zunehmendes Interesse, nicht zuletzt wegen der demografischen Entwicklung.
Ethische Fragen in Zeiten des Fachkräftemangels
Ein zentrales Thema war der drastische Anstieg pflegebedürftiger Menschen in den kommenden 20 Jahren. Dr. Ranisch, ebenfalls aus dem Bereich der Philosophie, zeigte in einer kurzen Präsentation, wie sich die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland verdoppeln wird. Die Frage sei also nicht mehr ob, sondern wie soziale Robotik sinnvoll eingesetzt werden kann.

Dabei wurde deutlich: Roboter sollen keine Pflegekräfte ersetzen. Vielmehr können sie entlasten – etwa durch Erinnerungen an die Medikamenteneinnahme oder einfache Unterhaltung im Alltag. Aber auch kritische Stimmen wurden zitiert: Möchte man wirklich seine intimsten Gedanken mit einer Maschine teilen? Ist ein roboterhaftes „Ich freue mich“ dasselbe wie ein echtes menschliches Lächeln?
Zwischen Verantwortung und Vertrauen
Ein spannender Teil des Vortrags drehte sich um die ethische Verantwortung: Was passiert, wenn ein Roboter einen Fehler macht? Wer ist verantwortlich – der Entwickler, der Betreiber oder niemand? Der Wissenschaftler der Universität Potsdam stellte drei Modelle vor, wie man mit diesen Fragen umgehen kann – und betonte die Wichtigkeit eines ethischen Orientierungswissens, das die Technik begleiten müsse.

Der Vortrag mündete in einen lebhaften Dialog mit dem Publikum. Dabei wurde die Frage diskutiert, ob Roboter im Pflegealltag dauerhaft präsent sein sollen oder nur punktuell unterstützen. Die Meinungen waren differenziert: Ja zu technischer Hilfe, aber nicht als Ersatz für menschliche Nähe. Besonders eindrucksvoll war der Satz einer Teilnehmerin: „Die Maschine kann nett sein – aber sie riecht nicht nach Leben.“
Bürgerbeteiligung und Ausblick
Zum Schluss stellte Dr. Alexander Sakowsky von der Universität Potsdam die Ergebnisse der Bürgerkonferenz „Robotik in der Altenpflege“ vor, bei der 25 zufällig ausgewählte Potsdamerinnen und Potsdamer gemeinsam Empfehlungen für das Bundesministerium für Gesundheit erarbeiteten. Der Ansatz: Technik nicht über die Köpfe der Menschen hinweg entwickeln, sondern mit ihnen gemeinsam.

Abgerundet wurde die Veranstaltung wie gewohnt durch den kulinarischen Teil – der „Hochschulhappen“ im doppelten Wortsinn. Bei Kaffee, belegten Baguette und angeregten Gesprächen im Schatten des Museums ließen die Gäste das Erlebte sacken.

Der Seniorenbeirat Velten dankt allen Beteiligten für einen erkenntnisreichen und inspirierenden Vormittag – und freut sich schon jetzt auf die nächste Ausgabe der Hochschulhappen.

Weitere Informationen zum Projekt:
www.robotik-altenpflege.de
www.fgw-brandenburg.de/e-care
Kontakt: Prof. Dr. Robert Ranisch, Universität Potsdam
E-Mail: ranisch@uni-potsdam.de